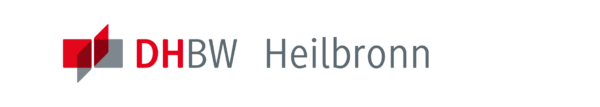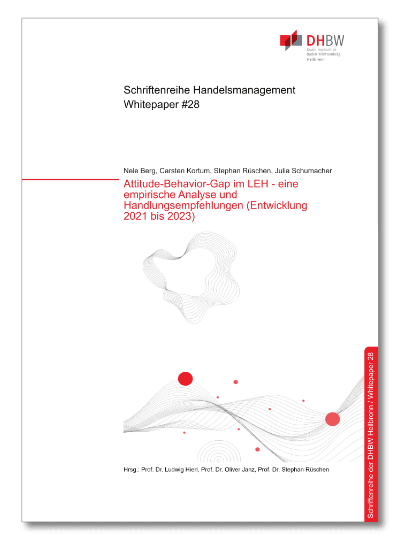Allenthalben hört man von so genannten Experten, dass die derzeit hohe Inflation in erster Linie auf Corona (Lieferengpässe, Arbeitskräftemangel) und die russische Invasion in die Ukraine (Energie- und Rohstoffpreisexplosion, steigende Lebensmittelpreise) zurückzuführen sei. Da die Europäische Zentralbank aber weder gegen die pandemie- noch gegen die kriegsbedingten Preissteigerungen etwas tun könne, sei die zinspolitische Zurückhaltung der aktuellen Lage angemessen.
Dazu aber ein kleines Gedankenexperiment: In einer Volkswirtschaft mit einer gegebenen Geldmenge und damit Kaufkraft müssten Preissteigerungen bei den einen Gütern (beispielsweise bei Energie oder Lebensmitteln) automatisch zu Preisrückgängen bei anderen Gütern (beispielsweise bei langlebigen Konsumgütern, Urlaubsausgaben) führen, da bei letzteren die Nachfrage sinkt. Jeder Euro kann schließlich nur einmal ausgegeben werden. Der für die Inflationsmessung relevante Warenkorb bliebe damit im Durchschnitt gleich teuer und das Preisniveau stabil.
Die gegenwärtig hohe Inflationsrate in der Eurozone – im Juli betrug sie 8,9 Prozent – muss also etwas damit zu tun haben, dass die Mehrausgaben an der einen Stelle nicht zu Minderausgaben an anderer Stelle führen. Oder anders formuliert: Es muss überschüssiges Geld vorhanden sein, welche die Gesamtnachfrage nach Gütern zumindest stabil hält. Woher stammt indessen diese überschüssige Liquidität?
Erstens sind während der Pandemie die Ersparnisse vor allem der privaten Haushalte gestiegen. Im Zuge der Lockdowns konnte schlichtweg kaum Geld ausgegeben werden. Stattdessen landete es trotz Nullzinsen auf der hohen Kante und fließt inzwischen aber wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf. Hohe Umsätze im Sommertourismus 2022 sind ein beredtes Zeugnis.
Zweitens geben die Staaten deutlich mehr Geld aus. Waren es zuerst die pandemiebedingten Mehrausgaben (Kurzarbeitergeld, Zuschüsse an Unternehmen, usw.), so sind es nunmehr Ausgabenzuwächse wegen des Ukrainekrieges (Rüstungsausgaben, Kredite an Ukraine, Flüchtlingshilfe usw.) und Maßnahmen zur Abfederung der Inflationsfolgen (9-Euro-Ticket, zusätzliches Kindergeld, etc.). Insgesamt forcieren die Staaten damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Allerdings drängt sich die Frage auf, woher die öffentliche Hand das Geld für die Mehrausgaben hat. Steuern wurden schließlich keine erhöht, sondern wie im Falle der hiesigen Mehrwert- oder Mineralölsteuer sogar temporär reduziert. Stattdessen verschaffte eine massive Kreditaufnahme am Kapitalmarkt den Staaten den notwendigen finanziellen Spielraum für zusätzliche Ausgaben. Jeder Kenner der Materie würde jetzt einwenden, dass bei einem begrenzten Kreditangebot eine zusätzliche staatliche Kreditnachfrage die Kreditnachfrage von Unternehmen und/oder Haushalten und damit deren Ausgaben verringern müsste. Dem war aber nicht so, wie insbesondere an den bis vor kurzem rekordhohen Immobilienkrediten abzulesen ist. Irgendwo muss aber das Geld herkommen, welches trotz steigender Preise für eine beständig hohe Gesamtnachfrage sorgt.
Drittens: Damit sind wir beim Kern des Problems angekommen. Inflation ist in den Worten Milton Friedmans immer ein monetäres Phänomen. Sie entsteht dann, wenn zu viel Geld zu wenigen Gütern nachjagt. Oder bezogen auf den gegenwärtigen Fall: Preisanstiege bei den einen Gütern führen deshalb nicht zu Preisrückgängen bei anderen Gütern, weil ein steter Geldstrom die Gesamtnachfrage nach Gütern alimentiert. Die Europäische Zentralbank hat seit der Finanzkrise 2008 und verstärkt im Gefolge der Eurokrise die Geldmenge im Euroraum regelrecht aufgebläht, wie an ihrer deutlich gestiegenen Bilanzsumme abzulesen ist. Bis 2020 hat sich dies aber nicht nennenswert in den Preissteigerungsraten der Euro-Mitgliedsländer niedergeschlagen, da das Geld im Bankensektor schlummerte – in der Liquiditätsfalle, um in der Sprache von John Maynard Keynes zu bleiben – und höchstens die Kapitalmärkte befeuerte, in der Realwirtschaft aber kaum zu spüren war. Im Umfeld der Coronakrise und des Ukrainekriegs braute sich dann jedoch der perfekte Sturm zusammen. Ein rückläufiges und teureres Güterangebot, gepaart mit einer steigenden Nachfrage – und das Ganze noch gefüttert mit ohnehin im Überfluss vorhandenem Geld, das nun in den Wirtschaftskreislauf gelangte – konnte nur in einer rasant steigenden Inflation münden.
Damit kommen wir aber auch schon (in aller Kürze) zur möglichen Lösung des Inflationsproblems. Natürlich kann die EZB nichts gegen den Gaspreisanstieg unternehmen. Es ist auch nicht ihre Aufgabe, einzelne Preise zu beeinflussen, sondern sich um das Preisniveau zu kümmern. Energiepolitik ist Aufgabe des Staates. Durch eine Abkehr vom russischen Gas und einer Hinwendung zu alternativen Energieformen kann langfristig der Energiepreisanstieg zwar gedämpft werden.
Um die Inflation aber kurzfristig – also auf Sicht von ein oder zwei Jahren – in den Griff zu bekommen, muss die EZB die Geldpolitik straffen, indem sie die Geldmenge verringert und die Zinsen deutlich anhebt. Geld, welches sich bereits im Umlauf befindet, dem Wirtschaftskreislauf wieder zu entziehen, ist indes kein einfaches Unterfangen. Ökonomen vergleichen dies gerne mit Zahnpasta, welche zwar leicht aus der Tube herausgedrückt, nicht aber zurück in die Tube getan werden kann. Infolgedessen verbleibt vor allem die Zinspolitik als Instrument gegen die Inflation. Aufgrund steigender Zinsen
- sollten die privaten Haushalte wieder mehr sparen und weniger konsumieren,
- dürften die Unternehmen wegen gestiegener Kapitalkosten weniger investieren,
- müsste der Staat für seine Schulden höhere Zinsen bezahlen, wodurch ihm weniger Mittel für andere Ausgaben zur Verfügung stünden.
Rückläufige Ausgaben bei Privathaushalten, Unternehmen und Staat würden wohl unweigerlich zu einer Rezession führen. Ein anderer Ausweg aus der Inflation, so bitter das klingen mag, ist jedoch nicht in Sicht.
Und selbst wenn die beschriebenen Transmissionsmechanismen der Geldpolitik nicht funktionierten, gibt es ein weiteres gewichtiges Argument für deutliche Zinserhöhungen der EZB. Durch die im Vergleich zur US-Notenbank deutlich vorsichtigere Zinserhöhungspolitik hat der Euro gegenüber dem US-Dollar binnen Jahresfrist rund 15 Prozent an Wert verloren verloren. Entsprechend verteuerten sich alle in Dollar abgerechneten Importe. Schon um dieser importierten Inflation entgegenzusteuern, kommt die EZB nicht um deutliche Zinserhöhungen herum.
Sollten die Euro-Währungshüter den Weg höherer Zinsen einschlagen, dürfte ihnen massive Kritik entgegenschlagen, schließlich hatten es sich alle Kreditnehmer in dem Niedrigzinsumfeld bequem gemacht, nicht zuletzt die Staaten mit hoher Verschuldung. Diese Kritik hat sich die EZB aber letztlich selbst zuzuschreiben, da sie entgegen vieler Warnungen viele zu lange an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik festgehalten hat. Sie hat die Inflation überhaupt erst möglich gemacht. Der Weg heraus wird deshalb umso schmerzlicher. Jedes weitere Zögern dürfte die Lage aber weiter verschlimmern. Deshalb ist der EZB-Präsidentin Christine Lagarde zuzurufen: Machen Sie endlich Ihren Job!