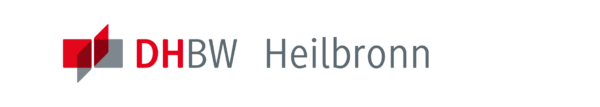Einblicke in den Lebensmittelhandel im Auslandssemester in Spanien
Überblick: Spanien besitzt einen vielseitigen Lebensmittelhandel, der von lokalen Märkten bis hin zu internationalen Supermarktketten reicht. Der Sektor ist gekennzeichnet durch eine starke Präsenz von Supermärkten und Discountern sowie von spezialisierten Lebensmittelgeschäften und Hypermarkten. Die Kultur des Lebensmitteleinkaufs in Spanien umfasst sowohl den täglichen Besuch kleinerer Läden und Märkte als auch wöchentliche Großeinkäufe in Supermärkten […]
Einblicke in den Lebensmittelhandel im Auslandssemester in Spanien Read More »